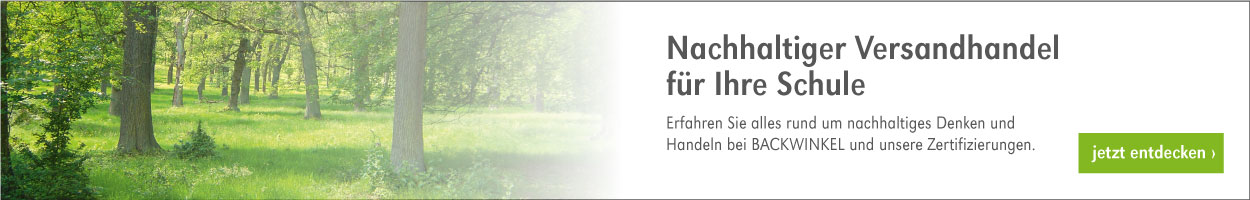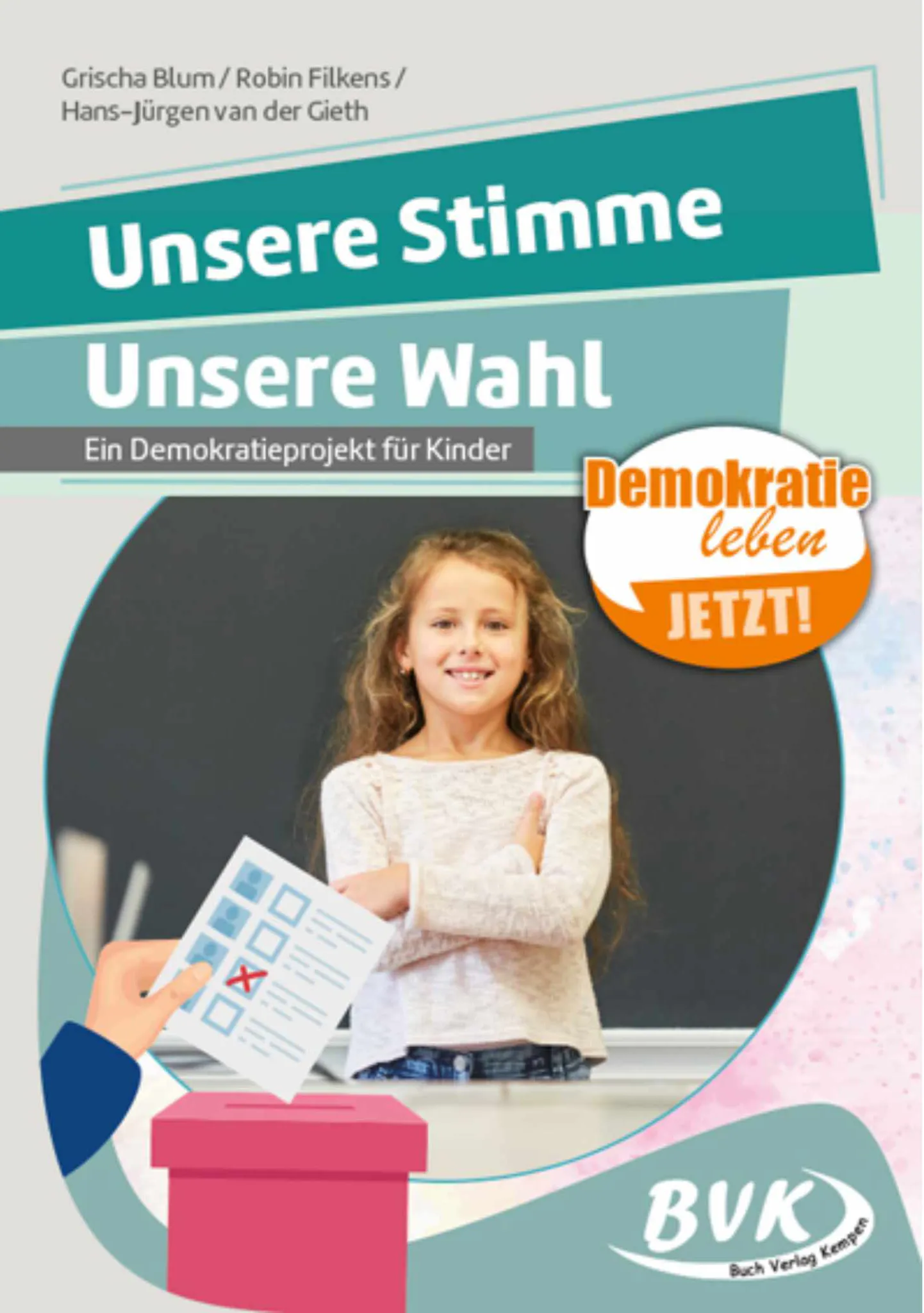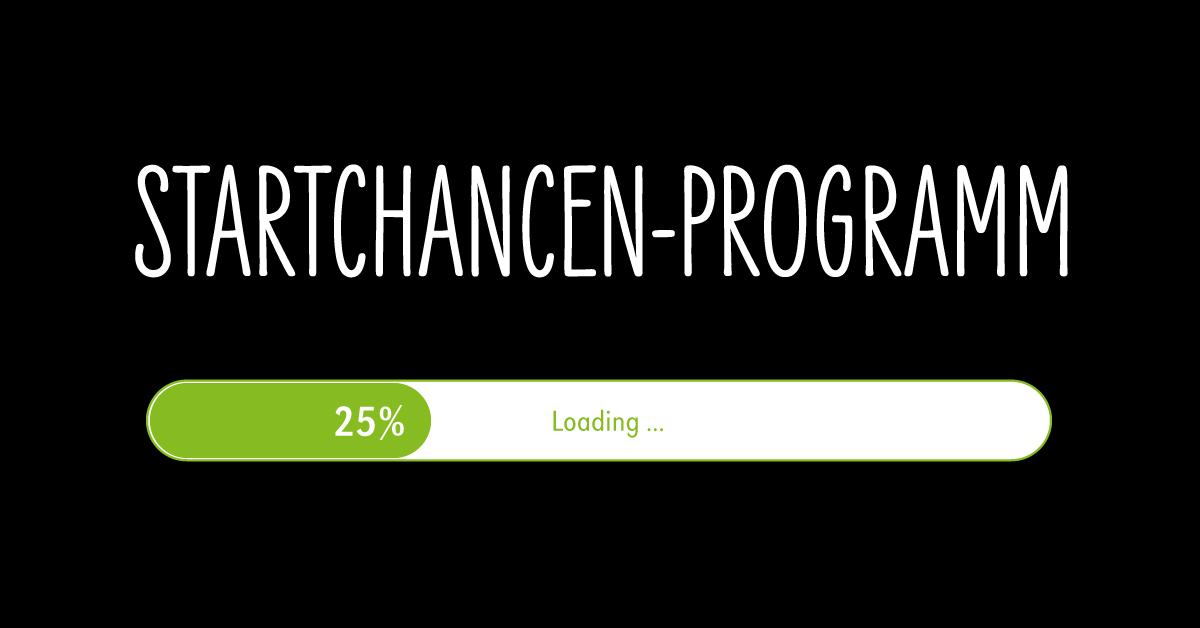Didaktische Perspektiven auf die Demokratiebildung im Schulunterricht
Demokratie leben – Jetzt!
Ein Gastbeitrag von Hans-Jürgen van der Gieth
Zu einer Demokratie gehören Mitbestimmung, freie Wahlen, Grundrechte, Freiheiten, Vielfalt, Toleranz und ein gutes soziales Miteinander. Kinder werden tagtäglich damit konfrontiert, ohne so genau zu verstehen, was das konkret bedeutet. Dabei ist es ganz entscheidend, junge Menschen früh an demokratische Merkmale heranzuführen – denn Kinder haben ein Recht auf Mitbestimmung, wollen mitwirken und mitgestalten. Nur: Wie können Sie Demokratiebildung im Schulunterricht überhaupt altersgerecht umsetzen?
© ADOBE Stock
In diesem zweiten Beitrag rund um die Demokratiebildung lesen Sie, wie wichtig die didaktische Perspektive ist und wie Sie das Thema im fächerübergreifenden Schulunterricht sinnvoll realisieren. Kostenloses Unterrichtsmaterial inklusive.
Inhalt
1. Didaktische Aspekte des Demokratielernens
1.1 Schülerorientierung als politdidaktisches Konzept
1.2 Erziehung zur Mündigkeit. „Lass es mich tun – und ich verstehe!“
1.3 Exemplarisches Lernen
1.4 Wissenschaftlichkeit
Kostenloses Unterrichtsmaterial
Jetzt hätten Sie gern eine praktische Hilfe, mit der Sie Ihren Schülerinnen und Schülern altersgerecht und nachvollziehbar vermitteln, was Demokratie ist, was es mit unseren Grundrechten, unserer Freiheit und einer Wahl auf sich hat? Klicken Sie auf den Button und laden Sie das »Kostenlose Unterrichtsmaterial für die 3. – 6. Klasse« einfach herunter.
Schülerorientierung als politikdidaktisches Konzept
Schülerorientierung stellt ein politikdidaktisches Konzept der emanzipatorischen Bildung dar. Autonomie, Mündigkeit und Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitbestimmung sowie demokratische Partizipation charakterisieren hierbei den Anspruch dieses didaktischen Prinzips. Dabei ist es zunächst einmal wichtig, die anthropogenen und soziokulturellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, ihr Lebensumfeld, ihr Verhalten in der Schule sowie ihr Verhältnis zum Unterrichtsgegenstand kennenzulernen.
Schülerorientiert bedeutet, Schülerinnen und Schüler in allen Phasen der unterrichtlichen Arbeit einzubeziehen. Dies beginnt bei der Planung und Vorbereitung des Unterrichts, erstreckt sich über den eigentlichen unterrichtlichen Prozess bis hin zur Reflexion über den Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler müssen mit ihren Bedürfnissen und Vorstellungen ernst genommen werden. Ihre Vorerfahrungen werden dabei in den Unterrichtsprozess integriert bzw. verstärkt zum Ausgangspunkt für den Unterricht gemacht.
Ein schülerorientierter Unterricht zielt auf „menschenwürdige“ Lernprozesse zur Entfaltung des gesamten menschlichen Potenzials. Erst in einer „schülerorientierten Atmosphäre“, in der sich die Kinder als ganze Person entfalten können, werden sie ihre volle Leistungsfähigkeit entwickeln. Das bedeutet auch, dass ein positives Unterrichtsklima herrschen muss. Die Schülerinnen und Schüler müssen spüren, dass sie als Person in ihrer Eigenart angenommen werden.
Als Lehrkraft sollten Sie deutlich machen, dass Sie Vertrauen haben, Ihre Schülerinnen und Schülern verstehen und akzeptieren. Geben Sie Ihre belehrende Rolle ruhig weitgehend auf und unterstützen Sie selbstbestimmtes Lernen. Nur in einer „wachstumsfördernden Beziehung“ zwischen dem Erwachsenen und dem Kind können Sie förderliche Erziehungs- und Bildungsarbeit leisten.
Durch personenzentrierte Haltungen wie Echtheit und Aufrichtigkeit, Wertschätzung und einfühlendes Verstehen lässt sich die Beziehung beschreiben. Die Meinungen der Kinder werden ernst genommen, ihnen wird ein hohes Maß an Eigenverantwortung zugestanden und auch zugemutet. Nicht Ihre Deutung als Lehrkraft steht im Vordergrund, sondern die Bedeutung einer Erfahrung für den anderen.
Erziehung zur Mündigkeit. „Lass es mich tun – und ich verstehe!“
Ein handlungsorientierter Unterricht ist in besonderer Weise geeignet, die pädagogischen Ziele von Demokratieerziehung zu realisieren: Erziehung zur Mündigkeit, zur selbstbestimmten Persönlichkeit, zu einem aktiven Gesellschaftsmitglied. Mit handlungsorientiertem Unterricht ist ein umfassendes unterrichtstheoretisches und -praktisches Konzept zu verstehen, das mehr als Kriterien wie Selbstständigkeit und Freiheitsräume der Schülerinnen und Schüler, praktisches Tun und Schüleraktivität erfüllt.
Der pädagogische Grundansatz eines handlungsorientierten Unterrichts liegt darin, eine Alternative zum verkopften Unterricht zu bieten, bei dem die Belehrung durch die Lehrkraft und das Reden über die Wirklichkeit anstatt der aktiven Auseinandersetzung dominieren. Merkmale wie Erfahrungsbezug, Vermittlung von Interessen, Lernen mit Kopf und Hand, Aktivierung vieler Sinne, Zielbestimmung, Offenheit, Soziales Lernen und gesellschaftliche Relevanz kennzeichnen das handlungsorientierte Lernen.
Exemplarisches Lernen
Von grundlegender Bedeutung beim politischen Lernen ist das Prinzip des exemplarischen Lernens. Das exemplarische Lernen ist in besonderer Weise geeignet, der in zahlreichen Unterrichtsfächern ständig anzutreffenden Stofffülle zu entgehen. Das Prinzip des exemplarischen Lernens bei der politischen Bildung zielt darauf ab, das Wissen zu vermitteln, das von allgemeiner, existenzieller Bedeutung ist.
Konkret auf die Inhalte des politischen Unterrichts bezogen bedeutet dies die Beschäftigung mit dem Schutz des Lebens bzw. dem Überleben des Einzelnen, der Gesellschaft, in der sich die Lernenden befinden bzw. der gesamten Menschheit. Selbstverständlich gehören in besonderer Weise auch Fragen nach der Menschenwürde, das heißt der Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, dazu. Aus dieser inhaltlichen Schwerpunktsetzung lässt sich die Notwendigkeit des exemplarischen Prinzips ableiten, das sich bei der Themenauswahl an diesen Überlegungen orientiert.
Wissenschaftlichkeit
Demokratieerziehung ist einer verantwortungsbewussten Sachlichkeit verpflichtet. Ohne grundlegende Informationen ist keine Bewusstseinsbildung möglich. Insofern sind Lehrkräfte der wissenschaftlichen Wahrheit verpflichtet. Sie bildet die Grundlage für jeden Unterricht, so natürlich auch des Demokratieunterrichts. In diesem Zusammenhang weise ich auf das psychologische Phänomen des sogenannten Bestätigungsdenkens hin. Danach favorisieren Menschen immer die Meinungen und Positionen, die der eigenen am nächsten kommen, die sie „bestätigen“. Dieses weit verbreitete Denken führt dazu, dass entgegengesetzte Positionen oft nicht gesehen bzw. ernst genommen werden. Es ist also wichtig, dass immer möglichst viele, auch gegensätzliche Positionen in der Auseinandersetzung mit politischen Themen wahrgenommen werden.
Beutelsbacher Konsens
Einen besonderen Stellenwert bei der politischen Bildung in der Schule nimmt der Beutelsbacher Konsens ein. Diese 1976 formulierte „Verpflichtung“ der Lehrkraft für den politischen Unterricht bestimmt bis heute die Debatte und stellt die Lehrerinnen und Lehrer immer wieder vor Herausforderungen in ihrer pädagogischen Arbeit. Konkret enthält der Beutelsbacher Konsens drei grundlegende Elemente:
- das Überwältigungsverbot, also die Forderung, im politischen Unterricht die Schülerinnen und Schüler nicht zu indoktrinieren
- das Kontroversitätsgebot, also die Beachtung kontroverser Positionen in Wissenschaft und Politik
- die Teilnehmenden-Orientierung, also die Befähigung der Schülerinnen und Schüler, in politischen Situationen ihre eigenen Interessen zu analysieren.
Die Forderungen des Beutelsbacher Konsenses haben bei vielen Lehrkräften – gerade in letzter Zeit – zu einer großen Verunsicherung geführt. Hierbei ging es vor allem darum, in welchem Rahmen sie zu konkreten politischen Fragestellungen eine wertende Stellung beziehen dürfen. Vor allem das Überwältigungsverbot des Beutelsbacher Konsenses führt zu der Verunsicherung, klar Position zu beziehen. Nach dem Beutelsbacher Konsens sind kontroverse Themen auch kontrovers zu behandeln. Innerhalb dieses Rahmens darf die Lehrkraft ihre eigene Sicht zwar ausdrücken, aber nicht als allgemeingültig hinstellen. Sie verstößt dabei nicht gegen das Neutralitätsgebot, wenn sie auch die eigene Betroffenheit zum Ausdruck bringt. Dies ist nicht nur erlaubt, sondern auch pädagogisch sinnvoll.
Die Schülerinnen und Schüler sollen sich selbst anhand von sicheren Quellen ein eigenes Urteil bilden. Es ist Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer verschiedene Perspektiven zu ermöglichen, zum Beispiel zu verfassungsfeindlichen Tendenzen einzelner Parteien sowie deren Protagonisten. Diese Frage ist – im Sinne des Schutzes unserer demokratischen Ordnung – durch entsprechende richterliche Entscheidungen geklärt. So dürfen Lehrkräfte, wenn es beispielsweise um den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine geht, Position beziehen – und sie müssen dabei die Menschenrechte verteidigen.
Lehrkräfte haben sich für die Werte der Demokratie, für die Menschenrechte und für die Grundsätze der verfassungsmäßigen Ordnung einzusetzen. Hierzu sind sie durch den rechtlichen Rahmen der Verfassung, durch das Beamtenrecht und das Schulrecht in den Bundesländern verpflichtet. Andersrum: Die strikte Einhaltung eines Neutralitätsgebotes entspräche nicht der Verpflichtung zur Förderung der Schülerinnen und Schülern zu mündigen Bürgern.
Dieser Beitrag ist ein Auszug aus der Infobroschüre für Lehrkräfte »Demokratie leben – Jetzt: Gedanken und Tipps zur Demokratieerziehung in der Schule«. (BVK Buch Verlag Kempen 2025)
Auch interessant:
Mit Fakten und hilfreichen Materialien vermitteln Sie unsere Staatsform
Miteinander lernen: So geht Demokratiebildung in der Grundschule
Klassensprecher: Darum ist die Demokratiebildung schon in der Grundschule 1. Wahl
Her mit der Bildungswende – darum ist politische Bildung schon in der Primarstufe wichtig
Rechtsextreme Einstellungen nehmen zu – Demokratiebildung ist eine gute Idee
Demokratiebildung in der Kita. So fühlen sich Kinder einbezogen und bestimmen mit
© Copyright – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte auf www.backwinkel.de sowie www.backwinkel.de/blog, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt.
Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei der BACKWINKEL GmbH. Bitte fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieses Internetangebotes verwenden möchten.
Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z. B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).
Gibts auch ein Gesicht hinter dem BACKWINKEL-Blog? Natürlich. Sogar fünf 😊. Wir – Lukas, Marvin und Tatjana – bespielen unseren Blog im LACHEN LEBEN LERNEN-Firmensitz in Hattingen.
Lukas kennt Onlinemarketing wie seine Westentasche, während Marvin unseren Beiträgen den passenden gestalterischen Rahmen gibt und Tatjana mit dem grünen Korrekturstift alles prüfend beäugt, was unsere Freelancerautorinnen Elisa und Christine (und gern auch Gastautoren) aus der Ferne für den BACKWINKEL-Blog nach ordentlicher Recherche schreiben.
Gemeinsam suchen wir ständig nach neuen, aufregenden Themen rund um das Thema Bildung im Kiga, der Schule und zu Hause. Und weil Sie da an der Quelle sitzen, freuen wir uns auf Ihre konstruktiven Rückmeldungen und Anregungen an blog[@]backwinkel.de
Viel Spaß beim LACHEN LESEN LERNEN!